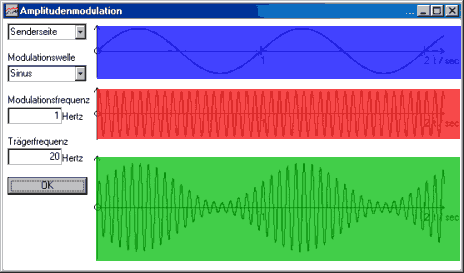
Sie befinden sich hier: Luisengymnasium > Fachschaften > Physik > Specials > Modulation
Will man Sprache oder Musik über weite Strecken vermitteln, liegt einem die Übertragung durch elektromagnetische Wellen nahe. Denn diese werden, anders als zum Beispiel Infrarot, von Hindernissen nicht gestört. "Übersetzt" man hörbare Frequenzen in elektromagnetische Strahlung, indem man einfach einem Schwingkreis den Takt eines Mikrophons aufzwingt, ist diese jedoch aufgrund der niedrigen Frequenz sehr energiearm und läßt sich nicht ohne gravierende Störungen empfangen.
Die Lösung besteht darin, die Amplitude einer hochfrequenten Schwingung im Takte des Mikrophons zu ändern, zu
modulieren. Der Empfänger macht die Modulation wieder rückgängig, er demoduliert, und gibt die eingegangen Signale am Lautsprecher wieder aus.Das Prinzip der Modulation läßt sich sehr leicht mit unserem kleinen Basic Programm für
Amplitudenmodulation erkennen. Aufgrund seiner kleinen Größe ist es schnell zu downloaden und kann unter Windows 9x einfach ausgeführt werden.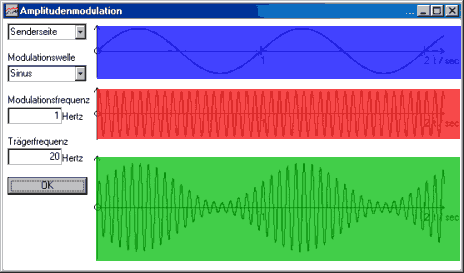
Der in diesem Screenshot blaugefärbte Bereich zeigt die Modulationswelle, also die Schwingung, die übertragen werden soll, den Eingang am Mikrophon. Der Einfachheit halber ist es hier eine Sinuskurve.
Der rote Bereich stellt die Trägerschwingung dar, deren Frequenz natürlich im Programm stark untertrieben ist, da sonst anstatt einer Schwingung nur ein dicker schwarzer Balken zu sehen wäre. In Wirklichkeit liegt sie im Kilohertz - Bereich, für manche Zwecke sogar im Megahertz - Bereich.
Ganz unten ist nun grüngefärbt die durch die obere Sinuskurve modulierte Trägerfrequenz sichtbar. Die Amplitude der Trägerwelle schwankt deutlich im Sinne der Tägerfrequenz.
Die Kurven im Bild folgen folgenden Formeln:
Modulationswelle: M(x) = a11 * sin(w 1*t);
Trägerwelle: T(x) = a2 * sin(w 2*t);
Ausgang: A(x) = a2 * sin(w 2*t) * ( k + a1 * cos(w 1*t) );
a1 und a2 sind die Maximalwerte der Kurven, also die Amplitude, hier a1 = a2 = 1. Am Ausgang ist k = 1.2, um ein schönes Bild zu erhalten.
w1 und w2 bezeichnen die Winkelgeschwindigkeiten, also die Frequenz, hier w1 = 1, w2 = 20.
Bei der Demodulation ist der springende Punkt, dass der Lautsprecher zu träge ist, um in der hochfrequenten Trägerfrequenz mitzuschwingen.
Würde man aber einfach die ankommenden Signale einfach ohne jegliche Änderung auf den Lautsprecher geben, würde sich rein gar nichts rühren. Das liegt daran, dass der Lautsprecher, der immer nur kleine Stöße von der Trägerfrequenz bekommt, immer wieder in beide Richtungen ausgelenkt wird. Daher muss man sich eines einfachen kleinen Tricks behelfen.
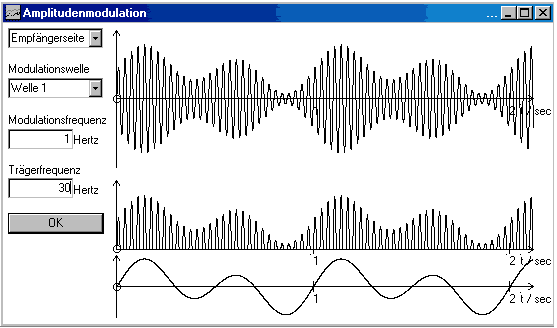
Man schneidet mit einer Diode einfach den Teil, der unter der t-Achse liegt, ab. Der Lautsprecher schwingt durch die ständigen Spannungsstöße der Trägerfrequenz wegen seiner Trägheit mit der Modulationsfrequenz, die ja schließlich übermittelt werden soll.
Auch dieses kann man sehr schön mit unserem vereinfacht darstellenden Programm simulieren. Hierzu stelle man ganz oben links Empfängerseite ein anstatt der Senderseite, die für die Modulation zuständig ist. Alle anderen Parameter können bei ihren alten Parametern belassen werden.
Um die Klangqualität zu verbessern, wird in der Praxis statt des Lautsprechers die Trägheit eines Kondensators ausgenutzt.
Mail an die Autoren
Christian Lang und Silvan Golega